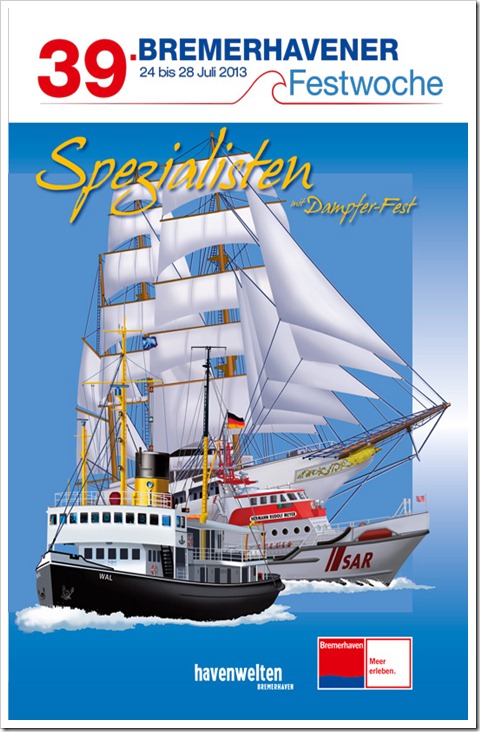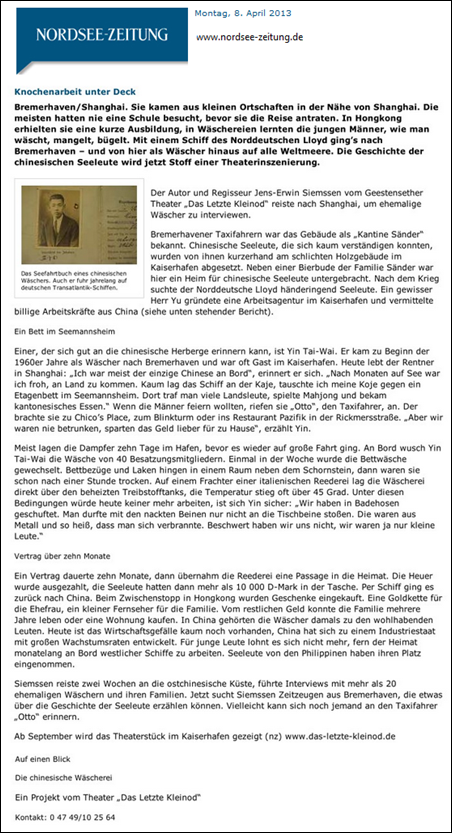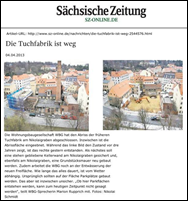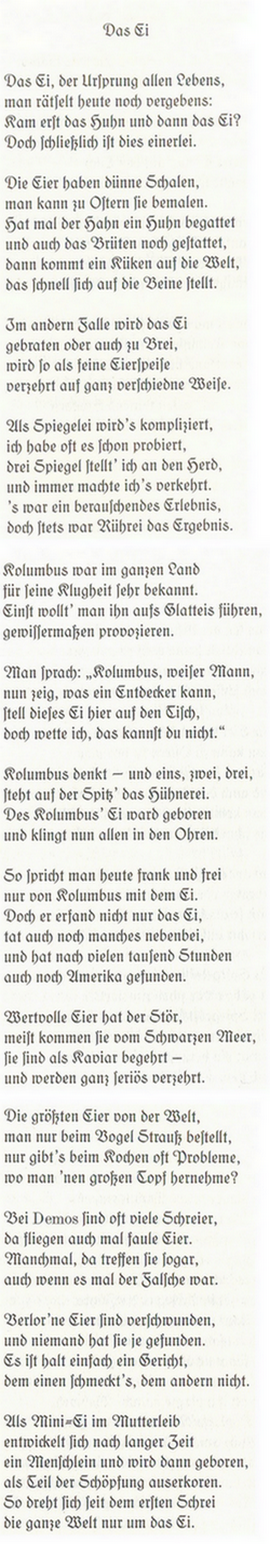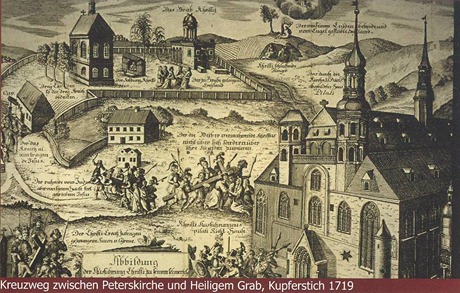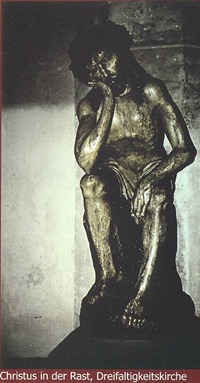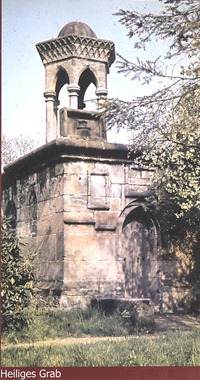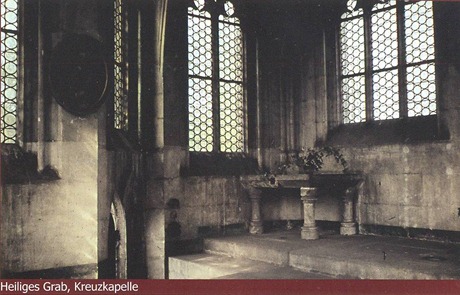Die Monatszeitschrift StadtBILD hat in ihrer Ausgabe Nr. 87 vom September 2010 einen Aufsatz von Herrn Wolfgang Stiller über die ehemalige Görlitzer Tuchfabrik Krause & Söhne veröffentlicht.
Die im Jahre 1863 und 1864 gebrachten gewaltigen Umwälzungen erforderten auch den Umbau der Pulvermühle. Es  entstand am Grünen Graben ein großes Webereigebäude mit Erdgeschoss, 3 Stockwerken und einem turmartigen Treppenhaus. Die bisherigen Kraftquellen genügten nun bei weitem nicht mehr. Es wurde ein Dampfkessel auf 6 Atmosphären Überdruck angeschafft, der für Steinkohlen-Feuerung auf Planrost eingerichtet war und bei dem als modernste Errungenschaft eine möglichst vollständige Rauchverbrennung berücksichtigt war. Der Erbauer war der Görlitzer Mechaniker Conrad Schiedt. (Hinzu kam auch 1863 eine neue Dampfmaschine). So war dann die Fabrik mit allen Neuerungen der Zeit ausgerüstet.
entstand am Grünen Graben ein großes Webereigebäude mit Erdgeschoss, 3 Stockwerken und einem turmartigen Treppenhaus. Die bisherigen Kraftquellen genügten nun bei weitem nicht mehr. Es wurde ein Dampfkessel auf 6 Atmosphären Überdruck angeschafft, der für Steinkohlen-Feuerung auf Planrost eingerichtet war und bei dem als modernste Errungenschaft eine möglichst vollständige Rauchverbrennung berücksichtigt war. Der Erbauer war der Görlitzer Mechaniker Conrad Schiedt. (Hinzu kam auch 1863 eine neue Dampfmaschine). So war dann die Fabrik mit allen Neuerungen der Zeit ausgerüstet.
Die Folgezeit entsprach nicht den Hoffnungen, die man sich mit der Modernisierung des Betriebes gemacht hatte. Die Kriegsjahre 1864, 1866 und 1870/71 brachten der Firma schwere Sorgen. Zahlreiche Angestellte und Arbeiter wurden zu den Fahnen gerufen, und wichtige Absatzgebiete waren versperrt. Besonders schwer traf in dieser Zeit auch der Tod des letzten Mitbegründers der Firma Carl Friedrich Krause am 7. August 1866. Am 17. Februar 1872 verstarb im besten Mannesalter sein Sohn Emil Krause. Da Edmund Krause dauernd krank war und sich dem Geschäft nicht so widmen konnte, wie es der Umfang desselben erforderte, wurde zu Beginn des Jahres 1872 Herr Okar Meißner berufen, in die Führung der Tuchfabrik einzutreten. Einmal verbanden ihn nahe verwandtschaftliche Beziehungen zur Familie Krause, und dann aber ließ ihn seine fachliche Vorbildung bei Jer. Sig. Foerster in Grünberg besonders geeignet erscheinen, in die Bresche zu treten, die der Tod und Krankheit in die Leitung des Unternehmens gerissen hatten.
Kriegsjahre 1864, 1866 und 1870/71 brachten der Firma schwere Sorgen. Zahlreiche Angestellte und Arbeiter wurden zu den Fahnen gerufen, und wichtige Absatzgebiete waren versperrt. Besonders schwer traf in dieser Zeit auch der Tod des letzten Mitbegründers der Firma Carl Friedrich Krause am 7. August 1866. Am 17. Februar 1872 verstarb im besten Mannesalter sein Sohn Emil Krause. Da Edmund Krause dauernd krank war und sich dem Geschäft nicht so widmen konnte, wie es der Umfang desselben erforderte, wurde zu Beginn des Jahres 1872 Herr Okar Meißner berufen, in die Führung der Tuchfabrik einzutreten. Einmal verbanden ihn nahe verwandtschaftliche Beziehungen zur Familie Krause, und dann aber ließ ihn seine fachliche Vorbildung bei Jer. Sig. Foerster in Grünberg besonders geeignet erscheinen, in die Bresche zu treten, die der Tod und Krankheit in die Leitung des Unternehmens gerissen hatten.
Mit Beginn der Blütezeit des neu gegründeten deutschen Kaiserreichs begann auch in der Firma Krause & Söhne neues Leben. Durch zielbewusste, rastlose Arbeit führte Herr Meißner das Unternehmen zu neuer Blüte.
Nachdem im Dezember des Jahres 1876 auch Otto Krause, der  jüngere Sohn des Mitbegründers Carl Friedrich Krause, gestorben war, gewann Herr Meißner als kaufmännischer Mitarbeiter am 1.4.1877 Herrn Rudolf Scheuner. Nachdem dieser anfänglich als Prokurist tätig war, wurde er bald als Teilhaber in das Geschäft aufgenommen. Herr Scheuner, der sich als außerordentlich begabter und tüchtiger Geschäftsmann erwies, widmete 20 Jahre hindurch der Firma seine ganze Arbeitskraft. Gerade er war es, der es verstand, sowohl auf dem inländischen als auch auf dem sich erschließenden ausländischen Absatzgebiet die Feintuche Krause und Söhne immer mehr einzuführen. Frankreich, Spanien, Skandinavien und bald auch Amerika zählten zu den besten Abnehmern. In diesen Jahren glücklichen und erfolgreichen Zusammenwirkens erwiesen sich die bestehenden Einrichtungen bald als unzulänglich.
jüngere Sohn des Mitbegründers Carl Friedrich Krause, gestorben war, gewann Herr Meißner als kaufmännischer Mitarbeiter am 1.4.1877 Herrn Rudolf Scheuner. Nachdem dieser anfänglich als Prokurist tätig war, wurde er bald als Teilhaber in das Geschäft aufgenommen. Herr Scheuner, der sich als außerordentlich begabter und tüchtiger Geschäftsmann erwies, widmete 20 Jahre hindurch der Firma seine ganze Arbeitskraft. Gerade er war es, der es verstand, sowohl auf dem inländischen als auch auf dem sich erschließenden ausländischen Absatzgebiet die Feintuche Krause und Söhne immer mehr einzuführen. Frankreich, Spanien, Skandinavien und bald auch Amerika zählten zu den besten Abnehmern. In diesen Jahren glücklichen und erfolgreichen Zusammenwirkens erwiesen sich die bestehenden Einrichtungen bald als unzulänglich.
Eine Erweiterung der maschinellen Anlage und damit auch der Fabrikgebäude wurden unumgänglich notwendig. Hiermit verbunden war natürlich auch die Vergrößerung der für jede Tuchfabrik besonders wichtigen Wasserversorgung. In den Jahren 1885 bis 1892 führte mit weitschauendem Blick diese erforderlichen Arbeiten Herr Meißner durch. Besonders beachtenswert ist dabei die Wasserversorgung. Teilweise wurde das Wasser aus der Neiße entnommen, teilweise aber einem Brunnen, der in der Nähe des Krankenhauses an der Berliner Bahnstrecke angelegt wurde und dessen Wasser in ein großes Reservoir geleitet wurde, das gegenüber dem Fabrikgebäude auf der anderen Seite des Grünen Grabens errichtet worden war.
verbunden war natürlich auch die Vergrößerung der für jede Tuchfabrik besonders wichtigen Wasserversorgung. In den Jahren 1885 bis 1892 führte mit weitschauendem Blick diese erforderlichen Arbeiten Herr Meißner durch. Besonders beachtenswert ist dabei die Wasserversorgung. Teilweise wurde das Wasser aus der Neiße entnommen, teilweise aber einem Brunnen, der in der Nähe des Krankenhauses an der Berliner Bahnstrecke angelegt wurde und dessen Wasser in ein großes Reservoir geleitet wurde, das gegenüber dem Fabrikgebäude auf der anderen Seite des Grünen Grabens errichtet worden war.
Als Herr Scheuner am 1.4.1897 wegen schwerer Krankheit seine Mitarbeit aufgeben musste, wurde Herr Rudolf Krause, der Sohn Emil Krauses, der bereits seit November 1894 in der Firma tätig war, zur führenden Mitarbeit berufen. Dieser brachte eine gründliche technische und kaufmännische Ausbildung für seine Stellung mit.
Im März 1899 nahm das Unternehmen die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) an, als deren Geschäftsführer Kommerzienrat Oskar Meißner und Herr Rudolf Krause zeichneten. Der jüngere Bruder des letzteren, Herr Richard Krause, hatte sich ebenfalls dem Tuchmacherberuf gewidmet und eine langjährige Fachausbildung genossen. Dieser wurde zur Prokura-Zeichnung betraut und rückte im September des Jahres 1912 zum Geschäftsführer auf.
Im Jahre 1913 konnten 400.000 Stück Tuch hergestellt werden, was einer Länge von etwa 2O Millionen Meter entspricht. Der beginnende 1. Weltkrieg fand die Firma auf einer angesehenen Höhe, und ihre Fachkräfte hatten im In- und Ausland einen guten Klang und erfreuten sich einer guten Nachfrage.
Der Krieg, die Revolution und die folgen- den Inflationsjahre gingen nicht spurlos an der Firma Krause & Söhne vorüber. Wie in jedem Unternehmen machten sich auch hier die unheilvollen Auswirkungen der Jahre 1914 bis 1923 bemerkbar. Dennoch aber begann dann die Firma, wenn auch noch gehemmt durch die wirtschaftlichen und politischen Schwierigkeiten der Nachkriegszeit, sich von neuem zu entwickeln. Obgleich der bejahrte Seniorchef, Geheimer Kommerzienrat Oskar Meißner, sich von der aktiven Führung der Geschäfte zurückziehen musste, bleibt er noch bis in die jüngste Zeit der treue Ratgeber der beiden anderen Geschäftsführer Rudolf und Richard Krause.
1931 werden von dem Unternehmen etwa 250 Arbeiter und etwa 30 kaufmännische und technische Angestellte beschäftigt. Die Art der Erzeugung entspricht der der Oberlausitzer überhaupt, d. h. es werden feine Herrentuche für Gesellschafts- und Straßenbekleidung angefertigt. Das Absatzgebiet ist in der Hauptsache Deutschland, indes wird auch die Ausfuhr nach allen Ländern der Welt, in denen Deutschland nach den handelspolitischen Verhältnissen überhaupt Eingang zu finden vermag, gepflegt.
Seiner alten Tradition getreu wird das Unternehmen auch in den künftigen Jahren zur Grundlage seiner Entwicklung den Gedanken machen, der die Gründer vor einem Jahrhundert leitete. Ehrbaren Bürgersinn zu verbinden mit unermüdlichem rastlosem Fortschritt.
Aus der Firma Krause & Söhne ist die Oberlausitzer Volltuchfabrik mit ihren dann 6 Werken hervorgegangen, die diese bewährte Tuchmacher-Tradition bis zu ihrer Abwicklung mit der Wende ab dem Jahre 1989 fortgeschrieben hat. Auch ihre Produkte waren als Exportartikel anerkannt und begehrt.
Wolfgang Stiller
Die Fotos zeigen die ehemalige Teichmühle, Rothenburger Straße (Teilansichten). In diesem Objekt wurde im Jahre 1837 die erste Görlitzer Dampfmaschine mit 10 PS in der Firma Gebrüder Bergmann und Krause installiert. Herr Wolfgang Stiller würde sich freuen, wenn ihm jemand (leihweise) weitere Fotos oder andere Dokumente über die Tuchfabrik zur Verfügung stellen kann.
Anmerkung zur Teichmühle:
bis 1956 befand sich ın der Teichmühle die Spinnerei der Oberlausitzer Volltuchfabrık. 1956 gab es einen Tausch. Die Oberlausitzer Volltuch erwarb das Grundstück auf der Uferstraße als Werk IV (Massagelände), und der dortige Holzverarbeitungsbetrieb zog in die Teichmühle Rothenburger Straße/Ecke Nikolaigraben. Bis zur politischen Wende befand sich in diesem Objekt eine Möbelfabrik.
Quellen:
Aus dem Nachlass eines ehemaligen Webmeisters der Oberlausitzer Volltuch Görlitz, der um 1935/36 bei Krause und Söhne gelernt hat.
Siehe auch R. Jecht: Topographie der Stadt Görlitz | Pulvermühle Seiten 726 — 727 l Teichmühle Seiten 725 – 726 | Tageszeitungen von 1931
Mit freundlicher Genehmigung des StadtBILD-Verlages Görlitz
Über den mittlerweile erfolgten Abriss der Tuchfabrik berichtete die “Sächsische Zeitung” am 19.2.2013 und am 4.4.2013.